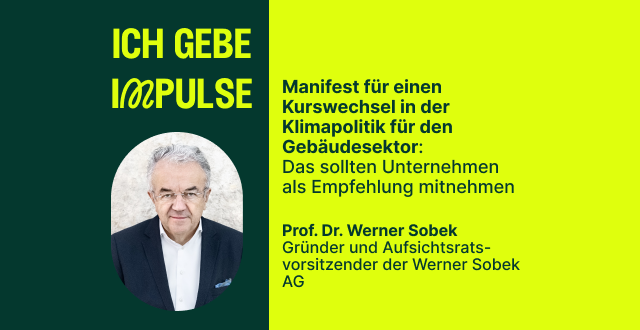Bei der diesjährigen IMPULS25, der Fachkonferenz von Ampeers Energy zur Dekarbonisierung der Wohnungswirtschaft, begeisterte Dr. Werner Sobek mit einem ebenso fundierten wie pointierten Vortrag über einen dringend notwendigen Paradigmenwechsel in der Klimapolitik des Gebäudesektors. Der Architekt, Bauingenieur und langjährige Professor für Leichtbau forderte eindringlich, sich von einem eindimensionalen Effizienzdenken zu verabschieden – und stattdessen den Fokus konsequent auf die Reduktion von Emissionen zu legen.
Energieeffizienz ist nicht gleich Nachhaltigkeit
Dr. Sobek zeigte auf, dass der Begriff „Energieeffizienz“ historisch aus einer ganz anderen Motivation entstand als viele heute annehmen. Die Energieeinsparpolitik in Deutschland nahm ihren Anfang 1976, im Kontext der Ölpreiskrisen und geopolitischen Spannungen. Ziel war es, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Erdölimporten zu verringern – nicht etwa, ökologisch zu handeln. Das damals verabschiedete Energieeinsparungsgesetz war demnach in erster Linie eine wirtschaftsstrategische Maßnahme zur Stabilisierung des Bundeshaushalts.
Doch seither hat sich dieser technokratische Effizienzbegriff in der öffentlichen Wahrnehmung tief mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs verwoben – ein Irrtum mit weitreichenden Folgen. Denn Effizienz heißt nicht automatisch emissionsarm, und schon gar nicht gerecht. Trotz Milliardeninvestitionen in Sanierungen sei der Raumwärmeverbrauch pro Kopf zwischen 2012 und 2022 praktisch konstant geblieben, so Sobek. Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Verbrauch 2015 so bei etwa 11.939 kWh pro Haushalt und stieg bis 2021 auf 12.216 kWh, was einem Anstieg von rund 2,3 % entspricht. Das zeigt: Der Effizienzbegriff greift zu kurz – besonders, wenn er als alleinige Richtschnur für klimapolitische Maßnahmen dient.
Systemfehler: Bedarf statt Verbrauch, Quadratmeter statt Mensch
Ein zentrales Problem liegt laut Sobek in der Wahl der Bewertungsgrößen. Das derzeitige System basiert auf dem theoretischen Bedarf eines Gebäudes – nicht auf dem tatsächlichen Verbrauch. Diese Diskrepanz führt regelmäßig dazu, dass Sanierungen und Neubauten auf dem Papier als energieeffizient gelten, in der Realität aber deutlich mehr Energie verbrauchen. Studien belegen eine Abweichung von bis zu 30 % zwischen berechnetem Bedarf und realem Verbrauch.
Das Umweltbundesamt hat so in einem Ad-hoc-Papier festgestellt, dass die normativ berechneten Energiebedarfswerte gemäß DIN V 18599 häufig über den tatsächlichen Verbrauchswerten liegen. Je höher der berechnete Bedarf, desto größer ist die Abweichung, die zwischen -10 % und -50 % liegen kann.
Hinzu kommt ein zweiter struktureller Fehler: Der Energieverbrauch wird pro Quadratmeter bewertet – nicht pro Person. Das bevorzugt Haushalte mit großen Wohnflächen und begünstigt wohlhabendere Bevölkerungsgruppen. Wer mehr Fläche bewohnt, darf mehr verbrauchen – und gilt dabei trotzdem als effizient. Eine soziale Schieflage, die in der Klimapolitik kaum diskutiert wird. Würde man hingegen den tatsächlichen Verbrauch pro Kopf messen und als Basis nehmen, wäre die Regulierung direkter, aber auch politisch heikler – schließlich würde sie persönliche Lebensführung unmittelbar adressieren.
Das eigentliche Problem: Emissionen, nicht Energie
Sobeks Kernforderung: Der Fokus der Klimapolitik muss sich von der Energieeinsparung zur Emissionsreduktion verschieben. Denn: Wir haben kein Energieproblem – die Sonne liefert ein Vielfaches unseres Bedarfs – sondern ein Energieträgerproblem. Solange wir fossile und verbrennungsbasierte Energieträger nutzen, stoßen wir Treibhausgase aus. Nicht der Energieverbrauch per se ist klimaschädlich, sondern die Art der Energiegewinnung.
Besonders kritisch sieht Sobek die Vernachlässigung der sogenannten grauen Emissionen – also jener CO₂-Ausstoß, der bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung, dem Transport und dem Rückbau von Baumaterialien entsteht. Diese machen bei Gebäuden und Infrastruktur zusammen rund 23 % der Emissionen im Bauwesen aus – werden aber von Gesetzgebern und Förderprogrammen nahezu ignoriert. Dabei wäre genau hier schnell, effizient und vergleichsweise kostengünstig eine massive Einsparung möglich.
💡 Graue Emissionen (auch vorgelagerte Emissionen) bezeichnen die Treibhausgasemissionen, die vor der Nutzungsphase eines Gebäudes entstehen – also nicht durch Heizung oder Stromverbrauch im Betrieb, sondern durch:
- Rohstoffgewinnung (z. B. Abbau von Sand, Kies, Kalk, Erz)
- Produktion von Baustoffen (z. B. Zement, Beton, Stahl, Glas, Dämmstoffe)
- Transport von Materialien zur Baustelle (teilweise über Tausende Kilometer)
- Baustellenbetrieb (Energie für Maschinen, Geräte, Bauhilfsmittel)
- Rückbau und Entsorgung (z. B. Abbruch, Deponie, Recycling)
Von Maßnahmenkatalogen zu klaren Zielen
Ein weiteres Problem sei die gesetzgeberische Überregulierung. Sobek kritisierte das Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit seinen 89 Seiten als überkomplex, unverständlich und innovationshemmend. Die Definition des Ziels sei darin unklar und verworren. Stattdessen plädiert er für eine radikale Vereinfachung:
„Das Emittieren klimaschädlicher Gase bei Herstellung, Betrieb, Umbau und Rückbau von Gebäuden ist zu vermeiden.“
Ergänzt um eine Übergangsverordnung auf Basis des international vereinbarten Emissionsreduktionspfads bis 2045, wäre dies aus seiner Sicht ausreichend als gesetzlicher Rahmen. Der Staat solle nicht vorschreiben, wie etwas gebaut wird – sondern was erreicht werden muss. Der Rest sei Aufgabe von Wissenschaft, Markt und Gesellschaft.
Hier zur Erinnerung die die Etappenziele des Emissionsreduktionspfads, festgelegt im Bundes-Klimaschutzgesetz:
- Bis 2030: Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 65 % gegenüber dem Niveau von 1990.
- Bis 2040: Reduktion um mindestens 88 % gegenüber 1990.
- Bis 2045: Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität.
Ein Manifest für den Wandel – und eine elektrische Stadt
Gemeinsam mit dem GdW Bundesverband für die Wohnungswirtschaft und den Kollegen aus der Wissenschaft hat Dr. Sobek das Manifest für eine neue Klimapolitik im Bauwesen verfasst. Die vier Kernpunkte:
- Abschied von Maximalstandards wie EH50 zugunsten eines optimalen, bezahlbaren Standards, der Emissionen, Kosten und Nutzen in Einklang bringt.
- Verständliche Zieldefinitionen anstelle technischer Detailvorgaben.
- Digitale Steuerung von Wärme und Kälte als Ergänzung zu baulichen Maßnahmen – etwa zur Vorbereitung auf zunehmende Sommerhitze.
- Konsequente Einführung der Kreislaufwirtschaft, um Materialerhalt und Recycling zur Norm zu machen.
Sobek beschrieb seine Vision der „elektrischen Stadt“: Gebäude ohne Schornsteine, Autos ohne Auspuffe, leise Straßen, saubere Luft – und eine hohe Lebensqualität. Beispiele wie ein vollständig aus Recyclingmaterialien errichtetes Gebäude oder ein seriengefertigtes Wohnheim mit extrem kurzer Bauzeit zeigten, dass diese Zukunft technisch längst möglich ist. Was fehle, sei gesellschaftlicher Wille, Vertrauen und eine zielgerichtete politische Steuerung.
Was jetzt zu tun ist
Am Ende seines Vortrags formulierte Dr. Sobek einen Appell: Die technischen Werkzeuge liegen bereit. Was jetzt gebraucht werde, sei eine gemeinsame Zielorientierung, eine verständliche Sprache und vor allem: Handeln. Kein Sprint auf den Mount Everest, sondern der nächste machbare Hügel sei das Gebot der Stunde. Ein kluger, sozial gerechter, wissenschaftlich fundierter Wandel – statt teurer Symbolpolitik.
🎥 Den vollständigen Vortrag von Dr. Werner Sobek können Sie auf unserem YouTube-Kanal nachschauen!
Außerdem können Sie sich auf der Website jetzt schon für die Herbst-Ausgabe der IMPULS25 anmelden.